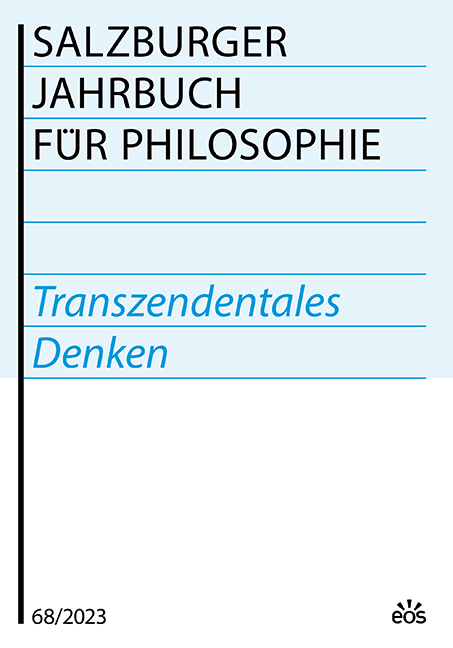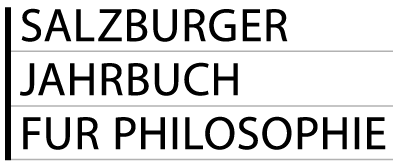Salzburger Jahrbuch für Philosophie 2023
SCHWERPUNKT – TRANSZENDENTALES DENKEN
TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER. Über das vermeintliche Ende der Transzendentalphilosophie, Christoph Asmuth
Die Transzendentalphilosophie ist in den Diskussionen um die „Letztbegründung“ zerschlissen und aus der Polemik ziemlich ramponiert hervorgegangen. Heute scheint Transzendentalphilosophie nur noch historisch behandelt zu werden. Der Neue Realismus attackiert die Transzendentalphilosophie und wirft ihr einseitigen und unhaltbaren Idealismus, zumindest aber Korrelationalismus vor. Hinzu tritt die Beschwerde, der der Transzendentalphilosophie eingeschweißte Subjektbegriff sei eine unangemessene Selbstermächtigung, der nur mit der dekonstruktiven Depotenzierung des Subjektes begegnet werden könne. Der vorliegende Beitrag will dagegen auf die systematischen Möglichkeiten transzendentalen Denkens hinweisen, ohne damit in die Falle eines Legitimationsdiskurses zu tappen.
KANTS CRITIK DER REINEN VERNUNFT. Begründung oder Erneuerung der Transzendentalphilosophie?, Sabrina M. Bauer
In der Kant-Forschung wurde es zwar nicht versäumt herauszustellen, dass Kant mit der Verwendung des „Systemausdrucks“ (Gideon, Der Begriff Transcendental, 25),Transzendentalphilosophie‘ die Revolution des Denkens terminologisch zu fassen sucht, die er mit der Critik der reinen Vernunft einläutet. Jedoch blieb der Sinn der kantischen Übernahme dieses tradierten Beriffs meist im Dunkeln. Anstatt die Untersuchungsperspektive allein auf den kantischen Text zu limitieren und zu fragen, wie man die unterschiedlichen Sinne und Bedeutungsnuancen vermitteln bzw. eine etwaige Inkonsistenz in Kants Begriffsgebrauchs auflösen soll, versucht der Text, ein adäquates Verständnis der Bedeutung des Begriffs ,Transzendentalphilosophie‘ bei Kant dadurch zu erlangen, dass er die Disziplin der Transzendentalphilosophie und insbesondere ihren Zustand im 18. Jahrhundert, auf den Kant reagiert und eine Neuausrichtung in Angriff nimmt, in den Fokus der Untersuchung rückt. Wenn man berücksichtigt, dass Kant mit dem Ausdruck ,Transzendentalphilosophie‘ einen traditionellen Begriff übernimmt, freilich nicht ohne ihn zu modifizieren, und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis der transzendentalen Prädikate (unum, verum und bonum) analysiert, wird die Bedeutung des transzendentalphilosophischen Charakters der Critik der reinen Vernunft deutlich.
WIE TRANSZENDENTALES DENKEN DIE GESTALT DER ERSTEN PHILOSOPHIE UND IHR VERHÄLTNIS ZUR THEOLOGIE BESTIMMT. Bonaventura, Thomas von Aquin und Meister Eckhart im Vergleich, Rolf Darge
Bonaventura, Thomas und Eckhart knüpfen an die Tradition des transzendentalen Denkens an, die von Pariser Theologen in den 30er Jahren des 13. Jh. zur philosophischen Begründung der Offenbarungstheologie entwickelt wurde. Danach führt die transzendentale Analyse unserer Verstehensinhalte auf ein Ersterkanntes, das den Horizont menschlichen Verstehens überhaupt eröffnet. Im Zuge ihrer Auslegung dieses Ersterkannten gelangen die drei Denker zu je einem je anderen Verständnis des Subjekts der Ersten Philosophie und ihres Verhältnisses zur Theologie – mit Konsequenzen für ihre jeweilige Haltung gegenüber der Autonomieforderung zeitgenössischer Philosophen an der Pariser Artistenfakultät. Bonaventura und Eckhart meinen, dass das Ersterkannte mit dem ersten Seinsprinzip zusammenfällt und sehen daher – jeder auf seine Weise – die Erste Philosophie in einer unauflöslichen Einheit mit der Theologie: Der Autonomieforderung der Philosophen begegnen sie daher mit Unverständnis (Eckhart) bzw. mit der Forderung einer reductio der Philosophie auf die Theologie (Bonaventura). Thomas dagegen betrachtet aufgrund der Annahme, dass der Endpunkt des transzendentalen Denkwegs nicht mit dem ersten Seinsprinzip zusammenfällt, Erste Philosophie und Theologie als selbständige Wissenschaften, die in einem Verhältnis wechselseitiger Ergänzung stehen. Ein solches Verhältnis wird von den Pariser Artisten, die um Anerkennung ihrer professionellen Identität ringen, nicht in Frage gestellt.
METAPHYSISCHE ANFANGSGRÜNDE DER QUANTENPHYSIK, Cord Friebe
Kant lehnt Leibniz’ Prinzip der Identität von Ununterscheidbarem ab, weil er ablehnt, dass empirische Objekte durch (Individual-)Begriffe gegeben werden. Bedingung der Gegebenheit von Gegenständen ist nach Kant vielmehr die (Raum-)Anschauung, durch die synthetisch referiert werde. Das metaphysische Problem der Individuation wird mit dem semantischen der Referenz analog verknüpft in der aktuellen Debatte um die Deutung der Quantenphysik. Auch dort wird das Leibniz-Prinzip abgelehnt, und inzwischen ist – entgegen der bisherigen Standard-Lesart – Kants Auffassung wieder eine ernstzunehmende Alternative. In diesem Aufsatz wird an diesem Beispiel der Rolle des Raumes ein erster Schritt gegangen zu den metaphysischen Anfangsgründen der Quantenphysik im Sinne Kants.
‚ANGLEICHUNG IM BEGRIFF‘. Historischer Austrag und systematische Vergewisserung eines des scotischen Transzendentalphilosophie zugrundeliegenden Problemkomplexes bei Leibniz, Kant und Hegel, Wouter Goris und Lars A. Heckenroth
Der vorliegende Essay sucht die Prinzipien (i.) Identität und Kompossibilität, (ii.) objektive Realität und (iii.) konkrete Totalität als eine systematische Trias zu begreifen, welche innerhalb der Metaphysik des Duns Scotus mit entscheidenden Neuerungen zum Tragen kommt und die in der Philosophie der Neuzeit produktiv fortwirkt sowie transformative Entwicklungen durchläuft. Es wird die These vertreten, dass die ‚Angleichung im Begriff‘ – d.h. die Bestimmung des Grundes der Möglichkeit der Wahrheit, im Sinne der inneren Objektivität des Begriffs – den Horizont ausmacht, vor dem jene drei Prinzipien in ihrer wechselseitigen Verflechtung bei Scotus erstmals in Erscheinung treten und vor dem auch die damit neueröffnenden Spannungen in der Nachfolge bei Leibniz, Kant und Hegel produktiv ausgetragen werden.
„EINEN WIRKLICHEN ANFANG […] HAT KANT NICHT ERREICHT“. Zur Kant-Kritik in Husserls Krisis-Schrift, Franz Gmainer-Pranzl
Edmund Husserl unterzieht in der Krisis-Schrift, seinem letzten, fragmentarisch gebliebenen Werk, die neuzeitliche Philosophie einer profunden Kritik, weil diese nicht zu den letzten Quellen des Verstehens vorgedrungen sei. In diesem Zusammenhang wirft er auch Immanuel Kant vor, seinen Ansatz der Transzendentalphilosophie nicht konsequent weiterentwickelt zu haben. Der vorliegende Beitrag untersucht Husserls Kant-Kritik, die er auch schon bei der Feier zum 200. Geburtstag Kants (1924) äußerte, und zeigt, dass Husserl dadurch letztlich seinen eigenen Ansatz einer transzendentalen Phänomenologie als Antwort auf die intellektuelle und kulturelle Krise Europas präsentieren will.
DER RELIGIONSPHILOSOPHISCHE HINTERGRUND DER TRANSZENDENTALPHILOSOPHISCHEN WENDE. Habermas rekonstruiert Kant, Michael Kühnlein
Der vorliegende Beitrag rekonstruiert den praktischen Sinn, den Habermas der transzendentalphilosophischen Wende Kants beimisst. Dieser Sinn weist bei Habermas eine religionsphilosophische Bedeutung auf, die noch in den Lernprozessen des nachmetaphysischen Denkens kritisch bearbeitet wird. Allerdings ist fraglich, ob in diesen Übersetzungsleistungen der praktischen Vernunft die überschießenden Momente der Religion ihren adäquaten Selbstausdruck finden. Kant jedenfalls ist nicht nur übersetzend, sondern im Blick auf die Problematik des Bösen stets auch ein Philosoph der Unübersetzbarkeit geblieben.
IMMANUEL KANT. Transzendentalphilosophie und Mystik, Reinhard Margreiter
„Mystik“ ist ein neuzeitlicher Begriff mit retrospektiver Anwendung auf ältere religiöse und philosophische Konzeptionen. Man versteht darunter allerdings oft sehr Verschiedenes und in der Philosophie reicht die Palette von der Vorstellung eines radikal „Anderen der Vernunft“ bis hin zur Gleichsetzung mit erweiterter, vertiefter Rationalität. Welche Position nimmt in diesem Zusammenhang die Transzendentalphilosophie ein, die eine der wichtigsten Zäsuren der westlichen Philosophiegeschichte darstellt und beansprucht, eine „vernünftige“ Kritik der Vernunft zu leisten? Für Kant ist Mystik – parallel zur vorkritischen Metaphysik – ein „Schwärmen“ von Vernunft, Gefühl und Einbildungskraft. Er kritisiert sie als esoterische Geheimlehre und hält sie für unfähig, Moral zu begründen. Zum Abschluss gehe ich einer Frage nach, die kürzlich von Autoren wie Christian Rößner oder Stephen R. Palmquist erneut zur Diskussion gestellt wurde: ob sich vielleicht doch, trotz aller Ablehnung, bei Kant selbst eine Art von Mystik auffinden lasse – und zwar angesichts des intuitiven (nicht: logisch-deduktiven) Begründungstatus‘ der praktischen Vernunft.
PEDRO HUERTADO DE MENDOZA ON THE TRANSCENDENTAL EXPLICATION OF BEING, Victor Salas
Mit Blick auf den spätscholastischen Begriff der „Supertranszendentalität“ untersucht der vorliegende Aufsatz, ob der spätscholastische Denker Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641) eine Darstellung des Seins entwickelt, die zu Recht als „supertranszendental“ verstanden werden kann. Die Supertranszendenz ist so weit gefasst, dass sie sogar die Transzendentalien übertrifft und nicht nur das Reale, sondern auch das Nicht-Reale umfasst, d.h. gedachte Objekte und unmögliche Objekte, die keinerlei Beziehung zur Existenz haben. Man könnte meinen, dass sich Hurtado, wenn er seinen Seinsbegriff im Sinne des logisch Möglichen oder Nicht-Widersprüchlichen entwickelt, in seiner metaphysischen Darstellung damit begnügt, die Bedingungen für das, was gedacht werden kann, zu erfüllen. Dementsprechend scheint die Existenz in Vergessenheit zu geraten. Ich argumentiere, dass Hurtados Metaphysik trotz seiner Aufmerksamkeit für die logische Möglichkeit auf die Dynamik der Existenz abgestimmt bleibt. Ich zeige, dass dies insbesondere dann der Fall ist, wenn er seine transzendentale explicatio entis anbietet, in der das Sein mehr als alles andere grundlegend im Sinne seiner Eignung zur Existenz verstanden wird, von der sich seine Erkennbarkeit ableitet, und nicht umgekehrt.
Freie Beiträge
DAS REICH DES UNGESPROCHENEN. Über die Bedeutung der intuitiven Erkenntnis in der Philosophie, Helmut Mai
Der Beitrag gibt einen philosophiegeschichtlichen Aufriss über die Bedeutung der intuitiven Erkenntnis in der Philosophie und stellt ihre Unverzichtbarkeit heraus. Von Platon bis Descartes findet sich die Anerkennung und Nutzung der intuitiven Erkenntnis in der Philosophie. Mit Kant beginnt die Entwicklung der Verbannung der intuitiven Erkenntnis aus der Philosophie, die in der heutigen Analytischen Philosophie ihren Abschluss gefunden hat. Die Phänomenologie ist eine Gegenkraft, aber ihr fehlt der aktuelle Bezug zur modernen Wissenschaft, auf die sich die Analytische Philosophie wesentlich beruft. Die Philosophie Michael Polanyis bereitet durch ihre Rehabilitierung der intuitiven Erkenntnis in der Wissenschaft die Rehabilitierung der intuitiven Erkenntnis in der Philosophie vor und ist bereits eine erste solche Rehabilitierung. Der Nutzen dieser Rehabilitierung erstreckt sich bis hin zur Gottesfrage.
SELBSTBESTIMMTES STERBEN IN WÜRDE. Würde und Autonomie als Argumente zum assistierten Suizid, Andreas M. Weiß
Seit 2022 ist in Österreich der assistierte Suizid legalisiert. In der ethischen Diskussion werden Menschenwürde und Autonomie als Argumente für gegensätzliche ethische Positionen verwendet. Ein differenziertes Verständnis zeigt, dass die normative Frage nach der ethischen Richtigkeit oder Falschheit von Suizidbeihilfe nicht direkt aus der Idee der Menschenwürde beantwortet werden kann. Das Recht auf Selbstbestimmung ergibt sich in diesem Zusammenhang wie die Religionsfreiheit aus der mangelnden Kompetenz des Staates, Fragen persönlicher Lebensgestaltung verbindlich zu beantworten. Ein Verständnis im Sinn personaler Autonomie im Unterschied zu moralischer Autonomie ist ausreichend. Damit sind Freiheitsräume für plurale Wertvorstellungen gegeben. Die Verantwortung für vernünftige und menschliche Lösungen liegt beim einzelnen Menschen. Im Konflikt sind trotz gegensätzlicher Urteile Toleranz und Respekt vor der persönlichen Gewissensentscheidung gefordert, um eine Basis für öffentliche ethische Diskurse zu bewahren.
Rezensionen
Gramelsberger, Gabriele (2023), Philosophie des Digitalen zur Einführung
von David Jost
Renn, Jürgen (2022), Die Evolution des Wissens – Eine Neubestimmung der Wissenschaft für das Anthropozän
von Heinrich Schmidinger
Rößner, Christian (2022), Kant als Mystiker? Carl Arnold Wilmans’ ‚Dissertatio philosophica de s i m i l i t u d i n e inter mysticum purum et Kantianam religionis doctrinam‘
von Christoph Böhr
Salas, Victor M. (2022), Immanent Transcendence: Francisco Suárez’s Doctrine of Being
von Rolf Darge
Wirtz, Markus (2022), Religionsphilosophie. Eine Einführung
von Franz Gmainer-Pranzl