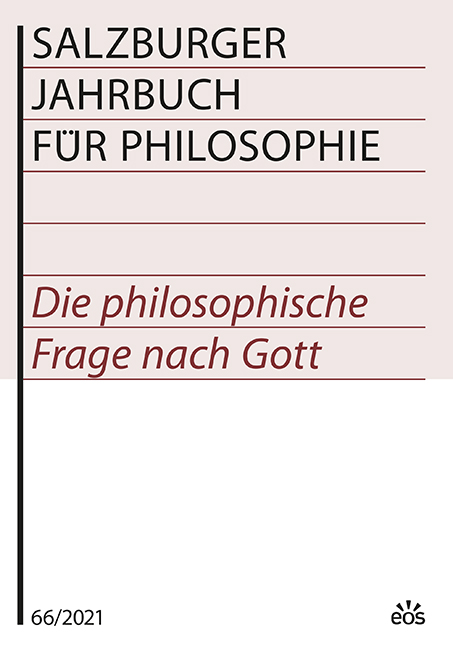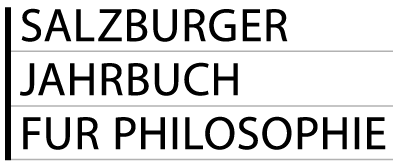Salzburger Jahrbuch für Philosophie 2021
SCHWERPUNKT – DIE PHILOSOPHISCHE FRAGE NACH GOTT
GOTT UND DER SINN DES LEBENS, Michael Zichy
In der Philosophie – vor allem in der analytischen angelsächsischen – spielt Gott auch in nachmetaphysischen Zeiten im Zusammenhang mit der Frage nach dem Sinn des Lebens erstaunlicherweise noch eine prominente Rolle. Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über die diesbezüglichen Diskussionen: Einer allgemeinen Darstellung der sinnstiftenden Rolle Gottes in den Religionen folgt ein Überblick über die diesbezügliche philosophische Auseinandersetzung. Danach gewährt der Beitrag detailliertere Einblicke in die Diskussion der beiden Fragen, die im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen: die Frage, ob sich Gott überhaupt widerspruchsfrei als sinnstiftende Größe denken lässt, und die Frage, ob Gott notwendig ist, damit das menschliche Leben Sinn haben kann.
TRANSZENDENTAL-ONTOLOGISCHES UND -PERSONALES BEZOGENSEIN DER SCHÖPFUNG AUF GOTT, Emmanuel J. Bauer
Die philosophische Rede von Gott stellte für die Philosophie schon immer eine besondere Herausforderung dar. In neuester Zeit führt sie weitgehend ein Schattendasein. Gott scheint der Vergessenheit oder Sprachlosigkeit anheimgestellt. Die bekannten historischen Versuche, Gott philosophisch zu denken, sei es aristotelischer, neuplatonischer, transzendentalphilosophischer, idealistischer oder auch prozessphilosophischer Prägung, weisen letztlich jeweils in gewissem Maß eine problematische Tendenz in Richtung pan-(en)-theistische Gott-Welt-Konfusion oder subjektivistischen Immanentismus auf. Ein auf den Schöpfungsgedanken rekurrierender, transzendental-ontologischer und -personaler Ansatz könnte sowohl der Unbegreiflichkeit, radikalen Verschiedenheit und Souveränität Gottes als auch der Freiheit und relationalen Autonomie der Geschöpfe gerecht werden.
NOCH EINMAL: ‹TRANSZENDENTALE ERFAHRUNG›, Heinrich Schmidinger
Nachdem das Thema ‹transzendentale Erfahrung› zwischen den 1960 und 1990er Jahren vor allem bei katholischen Philosophen und Theologen intensiv diskutiert wurde, steht es selbst im Zusammenhang mit der Gottesfrage kaum mehr im Mittelpunkt des Interesses. Eine Rückbesinnung auf die Thematik bei Kant, Hegel, Husserl und Heidegger zeigt jedoch, dass es keinesfalls als erledigt zu betrachten ist. Vor allem die Auseinandersetzung mit der Philosophie Heideggers, die sich in ihrer gesamten Entwicklung als Frage danach begreifen lässt, was ‹transzendentale Erfahrung› bedeutet bzw. ‹was› in ihr erfahren wird, lenkt den Blick auf die besondere Struktur derselben und somit auf jene der ‹natürlichen Gotteserfahrung›. Dass sich diese schließlich in dem zeigt, was man in einem ursprünglichen Sinne ‹Erzählung› nennt, resultiert aus einer Kritik an Heideggers Vernachlässigung der menschlichen Kommunikation, die in der Konstituierung jeglicher ‹Lebenswelt› eine alles bedingende Rolle spielt. Die Funktion des Erzählens besteht genau darin, die Erfahrbarkeit der Lebenswelt kommunikativ zu vermitteln und sprachlich darzustellen. Sofern wiederum das, was in der Erzählung zur Sprache kommt, nicht die Vergangenheit, sondern als Raum an Möglichkeiten die Zukunft ist, zeichnet sich die Struktur der transzendentalen (Gottes-)Erfahrungen darin ab, wie der Mensch in und mit Erzählungen existiert. Daraus ergibt sich auch die spezifische Form von Verifikation, die anlässlich solcher Erfahrungen möglich ist.
DIE PHILOSOPHISCHE REDE VON GOTT. Gott als Sinn des Sinns, Volker Gerhardt
Ausgehend von einer kurzen Charakterisierung des Verhältnisses von Wissen und Glauben in der sogenannten „Wissensgesellschaft“ wird die Einsicht erläutert, dass Wissen theoretisch wie praktisch auf Glauben angewiesen ist. Zugleich wird mit Blick auf die religionsgeschichtliche Entwicklung deutlich gemacht, dass auch der überlieferte Glauben notwendig auf Wissen bezogen war. Dem christlichen Evangelium kommt das besondere Verdienst zu, sowohl die Trennung wie auch die wechselseitige Angewiesenheit von Glauben und Wissen zum Ausgangspunkt seiner Botschaft gemacht zu haben. Und vor diesem Hintergrund wird die These des Autors entfaltet, dass der von ihm zwar nicht gegenständlich, aber mit umso größerem Nachdruck existenziell verstandene Sinn der Rede von Gott als unverzichtbar angesehen werden muss.
REDE VON GOTT, REDE ZU GOTT UND WORT GOTTES. Ein philosophischer Zugang zu einem biblischen Text, Clemens Sedmak
Biblische Texte gelten nach christlichem Verständnis als „Wort Gottes“, als Ausdruck eines dynamischen Offenbarungsgeschehens, in dem sich Gott den Menschen mitteilt. Ein besonderes Sprachspiel sind Gebete, die sich in biblischen Texten finden. Hier findet sich eine Rede zu Gott im Wort Gottes. Hier zeigen sich Artikulationen einer Gottesbeziehung in einem Textkorpus, das Gottes Beziehung zu den Menschen ausdrückt. Der vorliegende Beitrag geht mit erkenntnistheoretischen Mitteln an einen biblischen Text heran – an das Gebet, das König Hiskija, sein Ende vor Augen, spricht (2 Kön 20,2–3). Dabei werden die folgenden Fragen leitend sein: Was sagt ein Gebet über Gott aus? Was lernen wir über Hiskijas Glaubensüberzeugungen aus dem Gebetstext? Ich gehe in vier Schritten vor: (1) Hiskijas Gebet ist Ausdruck eines hohen Erkenntnisanspruchs; (2) das Gebet zeigt verborgene Ansichten über Gott und die Welt; (3) das Gebet spiegelt die geistliche Geschichte Hiskijas; (4) das Gebet hat sozialethische Implikationen und deutet die soziale Dimension des eigenen Leidens an. Auf diese Weise soll die Fruchtbarkeit einer philosophischen Auseinandersetzung mit biblischen Gebetstexten gezeigt werden.
VERNUNFT UND GLAUBE, Josef Schmidt
Vernunft und Glaube werden in einem erweiterten Vernunftbegriff einander zugeordnet. Nur er ermöglicht eine wahrheitsorientierte Kommunikation über Letzt-Überzeugungen. Im Hinblick auf diese Kommunikation lassen sich die klassischen Gottesbeweise als performativ gültige Transzendenzargumente rehabilitieren. In ihrer gestuften Abhängigkeit voneinander münden sie schließlich in das Theodizee-Problem. Eine Antwort darauf konnte freilich nur vom absoluten Herrn des Lebens gegeben werden, indem dieser sich dem tödlich verletzten und fragwürdig gewordenen Leben selbst unterwarf und ebenso die Unbesiegbarkeit des Lebens erwies. Dies ist sein großes Geschenk an uns, das unsere „vernehmende“ Vernunft mit sich selbst in Übereinstimmung zu bringen vermag und uns allen zum Leben und zu uns selbst Ja sagen lässt.
„IN GOTT UND UNS, DIE WIR GUT SIND, SIND GUTER UND GUTHEIT AUF ANALOGE WEISE EINS.“ Das Geschöpf als Analogat Gottes in der philosophischen Sicht Meister Eckharts, Rolf Darge
In kritischer Wendung gegen Mojsischs einflussreiche Deutung der Analogielehre Eckharts bringen neuere Studien (Schiffhauer, Aertsen) den Einheitsgedanken in diesem Lehrstück zur Geltung. Dabei deuten sie die analoge Einheit des endlichen Seienden mit Gott in den allgemeinsten oder transzendentalen Vollkommenheiten als eine Kausalbeziehung, so dass sie im Wesentlichen mit der analogen Kausalität zusammenfällt. Diese Untersuchung argumentiert für eine begriffliche Trennung von Analogie und analoger Kausalität: Die analoge Einheit besteht im Falle der transzendentalen Vollkommenheiten formal in einer Zeichenrelation, in der das Sekundäranalogat (das Geschaffene) das Primäranalogat (das Sein, Eine, Wahre, Gute, das Gott ist) anzeigt und darstellt. Die Darstellungsfunktion beruht jedoch auf einem kausalen Zusammenhang. Er besteht nicht in einer wirkursächlichen, sondern in einer extern-formalursächlichen Beziehung. Durch eine unmittelbare Beziehung zur Exemplarursache konstituiert sich das endliche Seiende als Medium der Darstellung des göttlichen Seins. Eckhart führt auf diese Weise die augustinische Tradition der Lehre vom Zeichen und von der Spur weiter.
DAS FRAGEN NACH GOTT IN SEINER ZEIT. Überlegungen zur Phänomenalität der Offenbarung im Anschluss an Heidegger und Marion, Walter Schweidler
Heidegger, der radikale Kritiker aller „Onto-Theologie“ im Zentrum der Metaphysik, hat doch fundamentale Wirkung auf eine ganze Reihe theologischer Ansätze im zwanzigsten Jahrhundert ausgeübt. Zu den von Heidegger nachhaltig beeinflussten Denkern gehört auch Marion, der allerdings neben seiner phänomenologischen Philosophie eine ganz eigenständige Theologie entworfen hat, die sich in wesentlichen Hinsichten gegen Heideggers Auffassungen von Religion und insbesondere Christentum wendet. Es gibt jedoch einen Kreuzungspunkt zwischen Philosophie und Theologie, an dem sich zwischen beiden Denkern ein fruchtbarer philosophischer Dialog entzünden kann, nämlich das Paradox der Phänomenalität der Offenbarung. Marion betont durch seinen Grundbegriff der „gesättigten Phänomene“ und die paradigmatische Rolle, die er unter diesen dem Phänomen der Offenbarung zuschreibt, dessen absolute Unableitbarkeit und Einzigartigkeit, sieht sich dadurch aber der Problematik ausgesetzt, eine Vermittlung zwischen der Offenbarung und ihrem Wahrheitsanspruch zu denken, den der Mensch nur aus dem Verhältnis ermessen kann, das alle Phänomene, die ihm gegeben sind, miteinander verbindet. Angesichts dieser Aufgabe erweist sich Heideggers geschichtlich konstituiertes Verständnis von Wahrheit in Verbindung mit dem Begriff des „Ereignisses“, der gegenüber der Geschichte wiederum einen Kontrapunkt bedeutet, als möglicher Schlüssel zu Marions Offenbarungsverständnis.
PHÄNOMENOLOGIE DES UNENDLICHEN ALS METAPHYSIK DER GASTLICHKEIT. Zur Gottesfrage bei E. Levinas, Jakub Sirovátka
Emmanuel Levinas stellt die Gottesfrage ganz neu. Der vorliegende Artikel versucht zu zeigen, worin diese neue Ausarbeitung der Frage nach Gott liegt. Levinas wählt zwei grundsätzliche Zugänge zu Gott: über die Phänomenologie der Idee des Unendlichen (unter Anschluss an R. Descartes) und über die Phänomenologie des Antlitzes des Anderen. Die theoretische Idee des Unendlichen übersteigt jede Denkmöglichkeit und wird letztendlich auf die praktische Ebene der ethischen Beziehung zum anderen Menschen zurückgeführt. Das Ergebnis der Philosophie von Levinas lautet: Die Gottesfrage lässt sich ausschließlich in Verbindung mit der ethischen Beziehung zum Anderen stellen und behandeln.
ZUM PHILOSOPHISCHEN GOTTESVERSTÄNDNIS DER JÜDISCHEN DENKER COHEN, BUBER UND ROSENZWEIG SOWIE ZU EHRENBERGS ANTWORT AUS CHRISTLICHER SICHT, Wolfdietrich Schmied-Kowarzik
Im Gegensatz zur christlichen Religion, die sich nur mit Hilfe der Philosophie als Monotheismus behaupten kann, die aber seit der Aufklärung mit der Philosophie in eine gegenseitige Ablehnung geraten ist, lebt der jüdische Glaube aus einem unmittelbaren Vertrauen zu Gott. Dies lässt sich besonders eindrucksvoll an den drei großen jüdischen Philosophen zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufzeigen, die daher in besonderer Weise zu Herausforderern des Christentums geworden sind. Hermann Cohen verlangt von den Christen, allererst zur wahren Einzigkeit Gottes zurückzukehren und Martin Buber fordert die Christen auf, sich auf den Gott zurückzubesinnen, dem sich Jesus ganz und gar anvertraute. Rosenzweig der von Anbeginn an mit seinen christlichen Freunden und Vettern in einem interreligiösen Austausch stand, erwartete von ihnen nichts weiter, als dass sie ihn so als Juden anerkennen, wie er sie als Christen akzeptiert. Nur Rosenzweigs Vetter, der Philosoph und protestantische Pastor Hans Ehrenberg, fand eine christliche Antwort auf die Herausforderung der drei jüdischen Philosophen. Doch was hier im Letzten zusammenfindet ist die philosophische Durchdringung des eigentlichen Sinns eines jeden Glaubens.
„VOLLKOMMENE FREIHEIT“. Ein Versuch, Gott zu denken, im Werk von Hermann Krings, Matthias Lutz-Bachmann
Der Münchner Philosoph Hermann Krings hat im Jahr 1970 in einem Aufsatz einen seinerzeit viel beachteten Versuch vorlegt, ausgehend von einer Analyse des Phänomens der Freiheit des Menschen einen philosophischen Begriff „Gottes“ zu bestimmen. Ausgehend von Kant und Fichte legt hier Krings die Gründe dar, die ihn veranlassen, im Konzept der Freiheit nicht nur eine „positive“ und eine „negative Freiheit“ zu unterscheiden, sondern auch die Dimensionen einer „unvollkommenen Freiheit“ vom Gedanken einer „vollkommenen Freiheit“. An die Bestimmung des Grenzbegriffs einer „vollkommenen Freiheit“ und deren Verwirklichung schließt Krings seinen eigenen Vorschlag an, wie „Gott“ unter den Bedingungen der Gegenwart philosophisch neu gedacht werden kann.
Freie Beiträge
DER PHILOSOPHISCHE ἚΡΩΣ. Ein daimonisches Hervorragen gestern und heute, Maximilian Niesner
Die Wirkgeschichte des platonischen Denkens für die philosophische Tradition Europas kann kaum überschätzt werden, wie Whitehead treffend festhält. V.a. der philosophische Ἔρως, wie Platon ihn im Symposion und Phaidros zur Sprache bringt, in der Figur des Sokrates performativ vorführt, ist ein Topos, der breite Rezeption erfuhr und als Grundlage der europäisch-philosophischen Tradition seit der Antike gelten kann. Dieser Aufsatz zeigt innerhalb des historischen Rahmens der Entwicklung der platonischen Akademie, des „mittelplatonischen“ Denkens und des Neuplatonismus, den Ἔρως in seinen orphischen Wurzeln, der platonischen Grundlegung und seiner mittel-/neuplatonischen Weiterentwicklung. Die Theorie einer inneren Dichotomie in Tradition und Interpretation des platonischen Ἔρως (John Rist), wird als systematisches Bindeglied zwischen mittelplatonischem Denken und Neuplatonismus vorgestellt, woran mit Rists Kritiker Anders Nygren ein Ausleuchten der orphischen Wurzeln des Ἔρως und dessen Rezeption durch frühe christliche Denker anschließt. Ausgehend von Plotins Rezeption des Ἔρως wird in der Darstellung seiner Transzendentalontologie ein Ausblick auf die Grundlage des Neuplatonismus gegeben, mit kurzer Referenz auf die Rezeption des Ἔρως bei Aristoteles. Eine Reflexion über die onto(theo)logische Verfasstheit (mittel-/neu-)platonischer Systeme bis in die Neuzeit leitet zu einer Einordnung des Ἔρως im Horizont von Rist und Nygren mit Bezug auf die Kritik des Ἔρως durch Emmanuel Bauer über. Am Ende steht ein Plädoyer, den existentiellen Charakter des Philosophierens ernst zu nehmen.
GLOBAL DENKEN? Zum Anspruch des Fremden in der Philosophie, Barbara Schellhammer
Der Beitrag befasst sich mit den Schwierigkeiten der Philosophie im Umgang mit Fremdem. Gerade in Zeiten einer immer dichter vernetzten Welt scheint die Frage nach Möglichkeiten eines Denkens, das sich anderskulturellen Traditionen öffnet, unabdingbar. Der erste Teil des Textes sucht nach Gründen für das schwierige Verhältnis der europäischen Philosophie mit Fremdem: Erstens gibt es Gründe, die im Selbstverständnis der Philosophie liegen, zweitens Gründe, die im Einfluss der Sprache auf unser Denken liegen und drittens psychologische Gründe, wenn wir uns selbst fremd werden. Der zweite Teil knüpft an diese Analyse an und stellt thesenartig drei Gesichtspunkte eines Philosophierens mit „globalem Anspruch“ vor: Zunächst muss das rationale Denken als Hauptzugang zur Philosophie in Frage gestellt werden, des Weiteren kann „globales Denken“ nicht nur gefordert, es muss vor allem auch geübt werden und letztlich sollte sich dies in einem Spannungsfeld zwischen der Orthaftigkeit der eigenen Kultur und der Ortlosigkeit in der Öffnung Fremdem gegenüber vollziehen, die Extreme an beiden Enden führen zu negativen Konsequenzen – in der Philosophie und darüber hinaus.
Rezensionen
Cesalli, Laurent/Imbach, Ruedi/De Libera, Alain/Ricklin, Thomas (†) (Hg.), Grundriss der Geschichte der Philosophie (völlig neu bearb. Ausgabe), Die Philosophie des Mittelalters Band 3, 12. Jahrhundert
von Rolf Darge
Danner, Helmut, Hermeneutik. Zugänge, Perspektiven, Positionen
von Franz Gmainer-Pranzl
Flasch, Kurt, Christentum und Aufklärung. Voltaire gegen Pascal
von Heinrich Schmidinger
Heichele, Thomas (Hg.), Mensch – Natur – Technik. Philosophie für das Anthropozän
von Sebastian Rosengrün
Hunz, Uwe, Ganzheit prima facie: Holistisches Denken in der Biologie und Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts
von Uwe Voigt
Joas, Hans, Im Bannkreis der Freiheit. Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche
von Heinrich Schmidinger